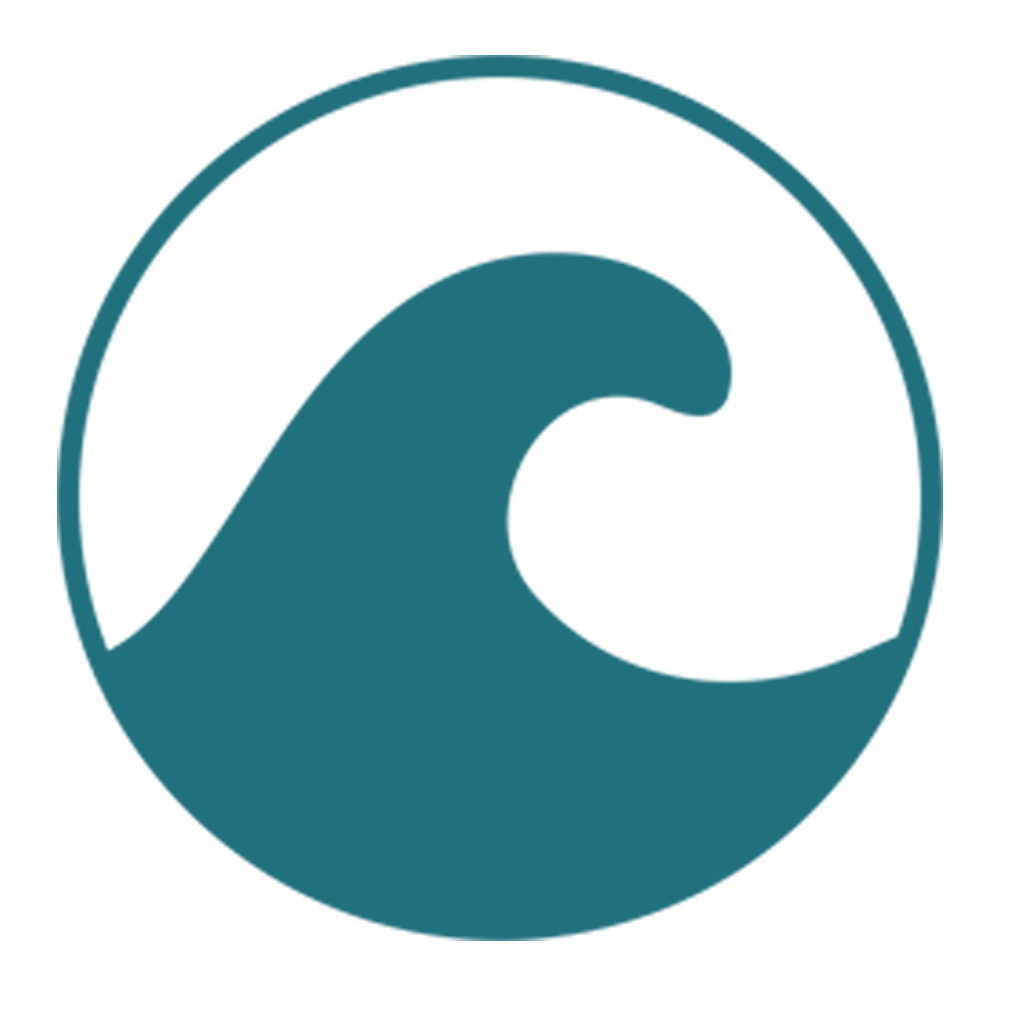Sanft wecken mich die Strahlen der aufgehenden Sonne aus meinen angenehmen Träumen. Ich strecke mich, habe beste Laune und bin energiegeladen. Vögel zwitschern. Ich schaue durchs Fenster direkt aufs Meer. Das Wetter: top! Die Wellen: ein Träumchen! Deshalb springe ich sofort mit meinem Surfboard ins Wasser. Nach einer unglaublichen Session frühstücke ich, denn obwohl ich gestern Abend erst angekommen bin, ist mein Kühlschrank gut gefüllt. Dann mache ich in Ruhe die nächsten Reisepläne. Anschließend gehe ich in den ganz nah gelegenen Coworking-Space und arbeite ein wenig – dank des Highspeed-Internets läuft alles perfekt. Am Abend hüllt mich der Sonnenuntergang in eine leichtfüßige, friedliche Stimmung. Life’s good.
Dazu kann ich nur sagen: Träum weiter!
Es hört sich immer so traumhaft an: Reisen, neue Orte und perfekte Wellen entdecken und die Kohle dafür einfach von unterwegs aus verdienen. Quasi nebenbei. Und genau das ist es in meinen Augen: ein Traum. Etwas, das wir uns in unserer Vorstellung (oder ich in meiner) ausmalen oder was Instagram uns immer wieder erzählen will, das aber so nicht existiert.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Menschen dieses Bild im Kopf haben, wenn ich von „Remote-Arbeit“ rede. Zugegeben, ein bisschen hatte ich diese Vorstellung anfangs auch – schade 😀
Die Liste der Gründe reicht von fehlender Routine, verschimmelten Airbnbs mit Vorschlaghammer-Sounds, Erschöpfung vom ständigen Organisieren bis hin zu stockendem oder komplett fehlendem WLAN. Das sind zwar die krassen Schattenseiten des Reisens, aber sie gehören eben teilweise dazu – und erschweren einen normalen Arbeitsalltag.
Für mich persönlich hat es sich deshalb bewährt, Reisen im engeren Sinne einfach vom Remote-Arbeiten zu trennen.

Letztes Jahr war ich mit dem Van in Spanien auf „Workation“. Was locker-flockig aussieht, war schön, aber auch schön anstrengend!
Reisen braucht Zeit
Beim Reisen ist es mein Ziel, in Orte, Landschaften oder Kulturen einzutauchen, Neues kennenzulernen und vielleicht auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich der Alltag anfühlt. Surfspots zu testen. Beziehungsweise deren Waschmaschinen. Und das braucht Zeit.
Immer unterwegs – auch im Kopf
Denn Reisen heißt auch, unterwegs zu sein. Vielleicht nicht permanent zu anderen Orten, aber ich habe gemerkt, dass ich im Kopf permanent damit beschäftigt bin, neue Eindrücke wahrzunehmen und mich an neue Rhythmen, Abläufe oder klimatische Bedingungen anzupassen. Deshalb braucht (mein) Reisen Zeit – zum Erleben, zum Organisieren, zum Verweilen, aber auch zum Verarbeiten.
„Manuelle Steuerung“ auf Reisen braucht Energie
In seinem Buch „Slow Travel“ stellt der Autor (keine bezahlte Werbung) unter anderem die Vermutung auf, dass unser Gehirn beim Reisen von Autopilot quasi auf „manuelle Bedienung“ umstellt, weil die normalen Routinen und Automatismen eben nicht funktionieren und wir uns an neuen Orten erstmal zurechtfinden müssen. Diese Beobachtung finde ich spannend und plausibel. Die manuelle Steuerung kostet neben Zeit auch einiges an Energie. Anfangs unterlag ich der Vorstellung, dass ich morgens an einem neuen Ort ankommen, surfen gehen und später dann noch etwas abarbeiten könnte. Und natürlich Natürlich lege ich unterwegs auch mal eine professionelle Foto-Session ein, tippe in einem Café einen Blogartikel oder erledige abends in der Unterkunft noch ein paar Dinge. Aber zwischen all den „Reise-Aufgaben“ einem Vollzeit-Job nachzugehen und sich voll darauf zu fokussieren, halte ich für nicht vollständig realisierbar.
Zumindest nicht, wenn man sich wirklich intensiv mit dem beschäftigen möchte, was oder wer einem auf der Reise begegnet.
Am Ende fühlte ich mich immer wieder unterbrochen oder abgelenkt vom Reisealltag und hatte oft das Gefühl, weder dem Arbeiten noch dem Reisen genug Aufmerksamkeit gewidmet zu haben.
Ortsunabhängiges Arbeiten
Etwas anders sieht es beim ortsunabhängigen Arbeiten aus. Wenn ich mir einen Ort aussuche, an dem ich länger bleibe (zum Beispiel einige Wochen oder Monate) und von dem aus ich nicht schon in der nächsten Woche weiterreisen muss, habe ich die nötige Zeit, mich sowohl auf den Ort einzulassen als auch mir eine Tagesstruktur aufzubauen. Deshalb nehme ich mir fürs Reisen meist frei oder arbeite nur sehr reduziert.
„Ortsunabhängig“ meint in meinem Fall vor allem, dass ich gerne unabhängig von einem Büro an einem bestimmten Ort bin. Nichtsdestotrotz steht mein Bürostuhl nicht am Strand – und das ist z.B. mit Blick auf ein ergonomisches Arbeitsumfeld auch gut so.
Das Schöne?
Suprise: Reisen und Remote-Work sind natürlich kombinierbar. Ich kann zuerst zwei Wochen herumreisen, um mich dann an einem Ort, an dem es mir besonders gut gefällt und wo ich alles habe, was ich brauche, längerfristig zum Arbeiten niederzulassen. Dass das gut tut, hat beispielsweise die AOK auch schon herausgefunden – im Artikel allerdings im Zusammenhang mit der „Workation“, die (oder besser gesagt dessen Bezeichnung) ich mittlerweile kritischer hinterfrage.
Für die, die es interessiert: Darauf achte ich beim ortsunabhängigen Arbeiten:
- Ich suche einen Ort mit möglichst konstanten Wellen für mein Level aus. In meinem Fall bin ich auch meist auf der Suche nach einem Ort mit mildem Klima. Muss ich mich zwischen beidem entscheiden, hat die Frostbeule in mir Vorrang.
- Ich achte darauf, dass es an dem Ort die Möglichkeit gibt, regelmäßig in einem büroähnlich ausgestatteten Bereich zu arbeiten. Dazu gehört natürlich auch eine gute Internetverbindung (z.B. Co-Working).
- Ich versuche, mir eine Tagesstruktur aufzubauen, die flexibel genug ist, damit ich nach den Gezeiten surfen gehen kann (das ist NICHT immer realisierbar).
- An Surftagen darf das Arbeitspensum kleiner sein, der Rest wird dafür an einem anderen Tag nachgeholt (auch das ist natürlich nicht immer machbar).
- Sozialleben: Das kann neben arbeiten, surfen, schlafen und essen manchmal zu kurz kommen. Deshalb achte ich darauf, nicht alleine zu „versauern“.
- Ausgleich: Wellenlose Tage nutze ich für Ruhe oder um anderen Hobbys nachzugehen. Sonst kann es eintönig werden.
Enjoy! Tina
Tina Gutes tun
Du magst, was ich schreibe? Ich freue mich übers Teilen, über Kommentare, über nette Worte, oder auch über einen Kaffee … Liebe geht raus!